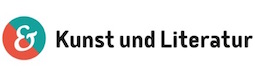Das Gespräch führte Beatrice Simonsen mit Friedrich Achleitner am 4. Februar 2014 in seinem Atelier in Wien anlässlich des Erscheinens seines Buches “Den Toten eine Blume. Die Denkmäler von Bogdan Bogdanović”. Im Gespräch wurden verschiedene Themen angeschnitten.
Der 1930 in Oberösterreich geborene Architekt, Architekturkritiker und Autor Friedrich Achleitner war im April 2014 Gast im LITERATUR RAUM im BILDHAUERHAUS.
LITERATUR und ARCHITEKTUR
Beatrice Simonsen: Stimmt es, dass Sie nach der Schule eigentlich nicht wegen der Architektur sondern wegen der Literatur nach Wien gekommen sind?
Friedrich Achleitner: Die Architektur war für mich die einzige Möglichkeit 1950 an die Akademie in Wien zu gehen. In Salzburg sind wir in der Gewerbeschule alle in einer Reihe gesessen, alle, die später wichtige Architekten in Österreich wurden: Puchhammer, Holzbauer, Kurrent, Gsteu – und ich. Aber weil ich mir das Studium in Wien eigentlich nicht leisten konnte, habe ich in Salzburg noch ein Jahr auf einer Baustelle gearbeitet. Meinen Eltern konnte ich nicht gut sagen, dass ich wegen der Literatur nach Wien gehe. Es war so: Immer, wenn ich etwas machen musste, hat es mich nicht mehr gefreut. Das hängt mit meinem Vater zusammen, wenn man bei dem nur angestreift ist, hat man schon eine Arbeit gehabt. Ich habe immer gezeichnet und wollte eigentlich Maler werden. Aber als ich dann in der Salzburger Gewerbeschule dauernd zeichnen musste, hab ich zum Schreiben angefangen. Das sind pädagogische Schäden. Es war einfach ein allgemeines Interesse da, in Wien Leute kennenzulernen, die ähnlich wie ich denken. Das ist dann gelungen mit Rühm und Artmann und Konrad Bayer.
Das war gleich am Beginn?
Nein, in der Klasse von Gütersloh gab es einen literarischen Kreis. Da war zum Beispiel Elfriede Skorpil, eine sehr gute Malerin – sie ist dann nach Norwegen ausgewandert – und die hatte einen literarischen Zirkel. Das war die erste Begegnung mit Leuten, die sich mit Literatur beschäftigt haben.
Später ging es dann mit der Wiener Gruppe weiter?
Es wird immer erzählt, dass die Wiener Gruppe gegründet worden ist, aber das ist falsch. Die Wiener Gruppe war ein kleiner Freundeskreis. Wir haben uns alle mit Literatur beschäftigt. Da waren auch der Ernst Jandl und die Friederike Mayröcker im engsten Kreis. Später haben wir das „cabaret“ (Anm.: 1957 und 1958) gemacht, da waren wir zu viert (Anm.: Achleitner, Bayer, Rühm, Wiener). Wien war ja eine finstere Stadt – obwohl: Wenn man zwanzig ist, ist es überall lustig! Durch die Geschichtsschreibung wird alles komprimiert und man glaubt, in den 50er Jahren war irrsinnig viel los, aber nichts war los! Unser „cabaret“, das waren zwei Vorstellungen in den zehn Jahren, zwei Abende! Was ist das? Gar nichts. Dann wurden wir von Roland Rasser nach Basel ins Cabaret Fauteuil eingeladen. Das gibt’s heute noch, ein schöner kleiner Kellerraum. Ich bin zusammen mit Rühm mit dem Motorroller hingefahren. Wir haben alles besprochen und dann hat Rasser gesagt: „Ich kann in Basel nicht vier unbekannte Leute auf ein Plakat schreiben, ihr müsst euch einen Namen geben.“ So haben wir uns 1961 erstmals Wiener Gruppe genannt. Gerhard Rühm hat das für die erste Publikation bei Rowohlt 1968 übernommen. Der HC (Anm.: Artmann) hat immer gesagt, die Wiener Gruppe hat es nicht gegeben, die ist nachher so benannt worden. Wir haben die gleichen Interessen gehabt, annähernd. Zwischen Rühm und Artmann ist ein Riesenunterschied und meine Sachen haben auch anders ausgeschaut.
Die „konkrete Poesie“…
Das war zwischen 1955 und 1962 ungefähr. Dann ist der Quadratroman 1972 erschienen, da könnte man auch sagen, dass das mit konkreter Poesie zu tun hat, aber so eindeutig ist das alles nicht…
Hat denn die Architektur etwas mit Schreiben zu tun?
Eigentlich nicht. Ich hab mich immer dagegen gewehrt, dass meine Literatur irgendetwas mit Architektur zu tun hat und umgekehrt. Ich hab da keine Beziehung gesehen, man kann sie konstruieren oder man kann annehmen, dass jemand, der ein visuelles Wahrnehmungsvermögen hat, auch schreibt, das ist nicht so unmöglich.
Aber hat die Architektur das Literarische verdrängt?
Natürlich, ich hatte ja Familie, ich musste von etwas leben und von der konkreten Poesie konnte man das nicht! Dora Zeemann, die Freundin von Heimito von Doderer, hat mich gefragt, ob ich nicht für die „Abendzeitung“ Architekturkritik schreiben will, das hat es damals noch nicht gegeben. Die „Abendzeitung“ war ein sogenanntes Revolverblattl, da haben alle unter Pseudonym geschrieben, auch Zeemann. Erika Hanel, die Generalsekretärin vom P.E.N. Club, war dort Kulturchefin, sie hat auch unter einem anderen Namen geschrieben. Das war für mich der Anfang. Die Zeitung ist aber zugrunde gegangen und dann hat mich Otto Schulmeister zur „Presse“ geholt, dort war ich zehn Jahre lang. Jede Woche habe ich eine Kolumne geschrieben, das ist eine Anstrengung, wenn man das nicht gelernt hat. Gleichzeitig hat mich Roland Rainer an die Akademie geholt, das war 1963. Damit bin ich total in der Architektur aufgegangen, so dass ich literarisch lange überhaupt nichts mehr machen konnte.
Der Architekturführer hat sicher auch viel Zeit in Anspruch genommen – das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie Sie das geschafft haben…
Ich kann es mir heute auch nicht mehr vorstellen (lacht). Jedenfalls bin ich 45 Jahre und 40.000 Kilometer in Österreich herumgefahren. Da war für die Literatur natürlich nicht mehr viel Platz.
Und jetzt haben Sie wieder Zeit?
Ich komm ja nicht los von der Architektur! Ich lass mich immer wieder zu etwas überreden…und dann komme ich nicht zu dem, was ich eigentlich machen will (lacht).
Geschichten schreiben?
Ja, das ist reine Erholung. Das hat nichts mit Arbeit zu tun, das ist eine Gaudi.
BURGENLAND
Aber zurück zu den 1950er Jahren. 1959 wurde das erste Bildhauersymposion in St. Margarethen im Burgenland abgehalten. Sie waren ja auch mit Karl Prantl, dem Gründer der Symposien befreundet…
Ja, wir waren befreundet. Da steht er (weist auf eine kleine Skulptur auf dem Regal). Das war ein schönes Unternehmen, mit interessanten internationalen Leuten. Und es war auch eine Brücke für Künstler aus dem Osten.
Waren Sie oft dabei?
Ich war im Sommer immer irgendwie dabei, das war eine tolle Anlage. Leider hat man jetzt die Bühne für die Oper hineingebaut. Eigentlich muss man sagen, dass die Atmosphäre von dem Steinbruch kaputt ist. Früher war der Blick von der Straße in den Steinbruch hinein etwas Besonderes. Da gibt es diese Gemälde von Herbert Boeckel – das war schon ein unvergesslicher Ort…
Haben Sie sich von der Atmosphäre dort auch künstlerisch beeinflussen lassen? Gerhard Rühm hat dort ja zum Beispiel einen Stein hinterlassen (Anm.: INNENEILTEINMANN).
Nein. In Wien war man ja mitten in der Szene. Da waren die verschiedenen Klassen an der Akademie und alles Mögliche, da kann man nicht wirklich sagen, wovon man beeinflusst worden ist.
Und architektonisch? War das Burgenland ein Freiraum wo man Dinge probieren konnte?
Die Auftraggeber waren doch wieder Wiener oder solche, die in Wien studiert haben. Prantl war zwar Burgenländer, aber studiert hat er in Wien. Das Rainer Haus (in St. Margarethen) und die Nikolauszeche von Ernst Hiesmayr (in Purbach) sind Bauten von Architekten von außen. Das war in den anderen Bundesländern auch nicht viel anders. Die Vorarlberger Schule, die dann so berühmt geworden ist, waren auch Leute, die in Graz und in Wien studiert haben.
In St. Margarethen wurde für die Bildhauersymposien ein eigenes Haus gebaut.
Ja, (Anm.: Johann Georg) Gsteu wollte zuerst transluzentes Plastik auf das Dach machen, nicht die Betonträger. Zum Glück hat er dann umgeschwenkt, weil diese Plastikteile sind sehr schnell gealtert und verdreckt und im Sommer wäre es natürlich irrsinnig heiß geworden drinnen.
Ja, die burgenländischen Sommer können sehr heiß werden.
Für uns Studenten war das schon immer ein Ziel, das Burgenland. Wir wollten zum Beispiel eine Diplomreise nach Italien machen, eine Art Maturareise. Wir dachten, wenn wir könnten von einem „reichen“ Architekten ein bissl Geld kriegen und dann können wir uns die Reise leisten. Von einem Architekten haben wir aber nur 50 Schilling gekriegt, das war alles, und damit sind wir mit dem Radl ins Burgenland gefahren. In Podersdorf haben wir gebadet, sind herumgetollt, haben was getrunken und Fußball gespielt. Da haben uns Burschen vom örtlichen Verein gefragt, ob wir nicht gegen sie spielen wollen. Die haben sogar ein Plakat gemacht: Podersdorf gegen Akademiker aus Wien. Und wir haben haushoch verloren! Das war unsere Diplomreise… (lacht).
BOGDAN BOGDANOVIC
Wie haben Sie denn Bogdan Bogdanovic kennengelernt?
In Wien bei einem Sommerfest von Boris Podrecca, das war 1998.
Als er schon im Exil in Wien war…
Ja, da war er schon im Exil, ich hab ihn vorher nicht gekannt und wir haben uns eigentlich sofort gut verständigt. Ich habe mich zehn Jahre mit seiner Arbeit beschäftigt und einen Tag vor seinem Tod – also ich war wirklich einen Tag bevor er gestorben ist im Spital bei ihm, da hat er noch ausgeschaut als würde er am nächsten Tag wieder heimgehen – hab ich ihm versprochen, dass ich das Buch mache. Und dann macht man es auch (Anm.: „Den Toten eine Blume. Die Denmäler von Bogdan Bogdanovic“, Zsolnay Verlag 2013). Das ist lohnenswert gewesen. Diese Denkmäler findet man nur, wenn man sie sucht. Sie sind oft nicht geschätzt, weil er Serbe war und die Denkmäler in Kroatien stehen. Es ist ein Wunder, dass man sich jetzt darum kümmert. Es wird auch renoviert, aber sehr langsam, weil kein Geld dafür da ist.
Ist er nicht von serbischer und von kroatischer Seite angefeindet worden?
Inzwischen ist er auf – fast – allen Seiten wirklich akzeptiert, bei den Kroaten noch mehr als bei den Serben. Für die Serben ist er ein Verräter, weil er den ganzen Nationalismus nicht mitgemacht hat.
Er hat ja hauptsächlich unter Tito gebaut…
In Jasenovac gab es Menschen, die fast einen Volksaufstand organisiert haben, weil man den Ermordeten (Anm.: KZ Opfer) kein Denkmal gesetzt hat. Tito hat nachgegeben, obwohl alle politischen Hierarchien dagegen waren. Bei der Eröffnung waren fast 40 000 Leute da und Tito hat Unruhen befürchtet. Er selbst hat sich nicht hin gewagt. Aber er hat verstanden, dass es für die Leute wichtig ist, deshalb wurde weiter gebaut. Es gab große Widerstände, dass man für Leute, die keine Helden und keine Kämpfer waren, mit viel Geld diese Denkmäler baut. Das haben viele nicht eingesehen. Bogdanovic ist aber auf die Geschichte und auf die Leute eingegangen, auf die regionalen Kulturen. Das ist eine Qualität. Tito hatte folgendes Kalkül: Er war mit Stalin zerstritten, Jugoslawien war bei den Blockfreien Staaten und Tito wollte sich von der sowjetischen Kultur und ihrer Kunst abnabeln, um im Westen anerkannt zu werden. Und Bogdanovic war der einzige, der in Frankreich bekannt war. Über ihn wurde schon in den 1960er Jahren in „L’Architecture d’aujourd’hui“ publiziert. Das war ein Architekt, den er herzeigen konnte und zwar im antisowjetischen Sinn. Dieses Kalkül ist aufgegangen. Heute müssen die verschiedenen ex-jugoslawischen Staaten erst wieder den Wert der Denkmäler erkennen.
Die Denkmäler sind über einen Zeitraum von 30, 40 Jahren entstanden…
Für Bogdanovic war das eine Wahnsinnsgeschichte. Er hat sein halbes Leben in einem „Kübelwagen“ gelebt, weil er oft wochenlang auf den Baustellen war und im Auto geschlafen hat. Er hat ja die meisten Entscheidungen vor Ort gemacht, mit den Steinmetzen geredet und so weiter. Er war schon einzigartig in diesem Jugoslawien – obwohl sowohl die Kroaten als auch die Serben schon in den 1920/30er Jahren gute Architekten waren. Er war also nicht in einem „luftleeren“ Raum.
Und Sie haben sich auf seinen Spuren wieder auf die große Reise gemacht…
Das waren diesmal nur 5.000 Kilometer (lacht).