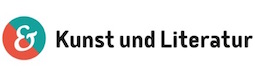Klaus Hoffer über das Schreiben, die Bieresch & das Burgenland
Im Rahmen des Anthologie-Projektes „Grenzräume. Eine literarische Landkarte im Burgenland“ sprach Wolfgang Millendorfer mit Klaus Hoffer am 7. März 2015 in Graz über dessen Buch „Bei den Bieresch“.
Wolfgang Millendorfer: Sehr viel ist über Ihre Texte geschrieben worden, vieles wurde in sie hineininterpretiert. Ist man damit immer zufrieden?
Klaus Hoffer: Immer ist man natürlich nicht zufrieden. Es gibt schon auch verrückte Kritiken, bei denen man sich fragt: Was soll das? Ich bin aber gut behandelt worden von den Kritikern.
Es ist ein kommunikationstheoretisches Prinzip, dass der Empfänger der Botschaft über den Inhalt der Botschaft entscheidet. Das Buch ist geschrieben, es kommt heraus – und man hat das Recht darauf verloren. Natürlich hat man hin und wieder das Gefühl, dass man überhaupt nicht verstanden worden ist, aber eigentlich ist das ein „unprofessionelles“ Gefühl, wenn man das so sagen kann.
Wie sieht es im Vergleich dazu mit der Rezeption Ihrer Übersetzungen aus?
Es gibt so etwas wie den „Sport“ des Übersetzer-Bashings, das kann mich sehr ärgern. In diesem Fall bin ich nur der Vermittler eines Buches. Das ist an sich aber eine schöne Arbeit und für mich auch ein Ersatz für das eigene Schreiben. Meist ist es ja so, dass die schwierigsten Sachen die interessantesten sind. Da überlegt man dann oft wochenlang.
Eine Frage, die sogar heute noch oft gestellt wird: Kommt ein dritter Teil der „Bieresch“ … oder hat sich das für Sie erledigt?
Innerlich habe ich ursprünglich einen dritten Teil angepeilt. Da war ich aber schon so drinnen in der Sprache – und dann hat es keinen Sinn. Dieser komplizierte Satzbau und so weiter, das wird dann zu einer Marotte, zu einem Schmäh.
Als ich mit dem dritten Teil angefangen habe, ist das ganz schnell gegangen. An den ersten beiden Teilen habe ich insgesamt acht Jahre geschrieben, in zwei Monaten vielleicht fünf bis zehn Seiten. Es gibt eine Warnung von Peter Handke an sich selbst im „Wunschlosen Unglück“. Da schreibt er an einer Stelle: „Jetzt muss ich aufpassen, dass sich die Geschichte nicht von selbst erzählt.“ Als ich bemerkt habe, dass es bei mir so wird, habe ich es beendet und aus.
Den dritten Teil gibt’s fertig?
Nein.
Fühlt man sich verfolgt, wenn die Fragen seit vielen Jahren immer wieder um dieses eine Werk kreisen?
Das wird schon eine Schwierigkeit meines Schreibens sein. Dass ich mir damals eingebildet habe, das ist wirklich etwas Gescheites, das ich da geschrieben habe – und das Gefühl gehabt habe, ich muss aufpassen, dass ich auf diesem Stand bleibe. Das hat mich sicher bis heute am Schreiben gehindert. Kafka – der ist allerdings ein ganz anderes Kaliber – hat einmal geschrieben: „Nur nicht das Geschriebene zu hoch einschätzen.“ Es hat in seinem Tagebuch allerdings gleichzeitig einen durchgestrichenen und später rekonstruierten Eintrag gegeben, wo er gesagt hat: „In mir schlägt das Herz Europas.“
Für einen Burgenländer birgt es eine zusätzliche Spannung, die Schauplätze Ihres Buches zu orten. Die Bieresch bewegen sich auf jeden Fall im tieferen Seewinkel …
Genau, in der Gegend von Pamhagen. In erster Ehe war ich mit einer Pinkafelderin verheiratet und hatte ein Bauernhaus in Schlaining gekauft. In der Zeit meiner ersten Ehe bin ich das ganze Burgenland abgefahren. Ich habe für das Burgenland insofern immer eine Schwäche gehabt, als ich als Bub einen Nennonkel in Mogersdorf hatte. Damals war ich schon irgendwie bezaubert.
Als ich später so durch das Burgenland gefahren bin, war ich sehr oft im Seewinkel. Dort bin ich auch das erste Mal auf einen dieser Bieresch-Höfe gestoßen. Das war für mich ganz sonderbar. Man konnte nicht einmal g‘scheit hinfahren, weil es damals nur Feldwege gab. Das hat mich sehr beeindruckt. Im Lauf der Zeit habe ich immer mehr solcher Höfe gesehen.
Angefangen hat es damit: Als ich auf der Rückfahrt aus dem Burgenland war, habe ich im Radio einen Vortrag des Wiener Ethnografen Károly Gaál gehört. Dessen Lebenswerk waren die Bieresch und über sie hat er im Radiovortrag gesprochen. Als ich von dieser Geschichte mit dem Rollentausch, dem Nachspielen hörte, fiel mir ein, dass ich genau das einmal geträumt hatte und plötzlich habe ich gewusst: Dorthin gehört dieser Traum.
Ich habe mich dann aber nicht kundig gemacht. Ich habe auch nicht „Die Puszta“ von Guyla Illyes gelesen, weil ich dachte, dass mich das zu stark beeinflussen könnte. Obwohl: Nachher hat es mir leid getan, weil da wären schon ein paar Dinge drin gewesen, die ich sofort wiederverwendet hätte.
Das hat mich an Ihrem Essay „Pusztavolk“ sehr beeindruckt, da schreiben Sie genau darüber …
Ja, genau. In der „Puszta“, da gibt es eine Stelle, wo es heißt: „Sie waren so arm, dass sie die Teller außen abgeschleckt haben.“ Also, das wäre etwas gewesen, das ich sehr gut irgendwo hineinbringen hätte können. Aber das habe ich damals eben eher vermieden.
Als ich Student war, habe ich ein dreiviertel Jahr in Seattle verbracht. Dort gibt es diese nordwestamerikanischen Indianerstämme, die den „Potlatsch“ (Anm.: Rituelles Fest) feiern. Und es gibt ein Buch von Marcel Mauss (Anm.: französischer Soziologe und Ethnologe), „Die Gabe“, in dem er genau über diesen „Potlatsch“ schreibt. Das habe ich auch erst nachher gelesen. Während ich an den „Bieresch“ gearbeitet habe, habe ich eigentlich immer nur Randliteratur dazu gelesen, bei der ich gewusst habe, dass sie mit der Sache selbst nichts zu tun hat, aber dass es eine Randgeschichte ist, die ich vielleicht verarbeiten kann.
Waren es zugleich – zumindest im ersten Teil – auch die Burgenländer selbst und diese, wenn man so will, mystische Landschaft, die Sie inspiriert haben?
Absolut! Unsere Hochzeitsreise haben wir damals in den Seewinkel gemacht, und wir verbrachten ein paar Nächte am Zicksee in einem Gasthaus. Dieses Gasthaus war völlig heruntergekommen und letz beisammen, wo wir übernachtet haben. Aber heute ist das dort ja total zersiedelt und grauenhaft, wie das aussieht, wirklich verheerend. Die Landschaft, die Lacken im Seewinkel, wo jetzt das Vogelschutzgebiet liegt – das ist damals sehr stimulierend gewesen. Ich hatte später immer das Gefühl: Die Stimmung dieser Landschaft, die kommt im Buch irgendwie heraus. Daran war mir sehr gelegen, dieses Steppenartige, dieses Sirrende, oder wie man es nennen soll, irgendwie einzufangen.
Gab es auch reale Vorbilder, die beim Schreiben ein Antrieb waren? Oder wäre das zu einfach?
Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich habe im Buch ja sehr viele Figuren Autoren nachgebildet. In dem Sinn ist es fast ein Schlüsselroman. Wolfi Bauer kommt vor, Widmer, Gerhard Rühm, Ossi Wiener, die ganze Wiener Partie. Und die Figur des Zerdahel – die habe ich dem Großvater meiner ersten Frau nachgebildet. Das war ein wunderbarer Mensch, er hatte diese verschrobene Art von Weisheit.
Eine Liebesgeschichte – als ich als Bub in Mogersdorf war – im Kino mit der Tochter des Kinobesitzers, die kommt übrigens auch im Buch vor. In dieser Familie meines Nennonkels wohnte außerdem dessen Schwiegervater. Der ist auch, als Person zumindest, in mich eingegangen. Ich habe ihm jeden Vormittag die Zeitung vorlesen müssen.
Könnten die „Bieresch“ auch in einer ganz anderen Gegend spielen?
Von der Idee her, von diesem surrealen Sujet her, hätte das natürlich auch woanders spielen können, das lässt sich überall verfremdend anwenden. Das hätte sehr wohl in den USA, bei den Nordwest-Indianern oder eher noch in Utah oder Arizona spielen können, wenn ich mich dort besser ausgekannt hätte. Das hatte auch diese Stimmung und diese sirrende Hitze.
Umso schöner, dass die Geschichte im Burgenland gelandet ist!
Ich habe das Burgenland immer sehr gemocht – und deshalb dort das Ganze „abgegrast“. Und diese Stimmung ist in das Buch eingegangen. Es sind auch viele Erlebnisse aus dem Südburgenland drinnen.
Auf das Südburgenland treffen ja viele dieser Attribute, die Sie vorher erwähnt haben, zu. Auch ich als Nordburgenländer verspüre gleich eine ganz andere Stimmung, wenn ich im Süden bin.
Ja, obwohl das Steppenartige, das betrifft mehr den Norden.
Auch das gefällt mir so sehr an Ihrem Buch: Auf gewisse Weise freut man sich, wenn man Namen und Ortsnamen, die man kennt, darin wiederfindet, wenn etwa eine Figur „Oslip“ heißt.
Es gibt ja sehr viele Namen im Buch, wobei ich fast immer die ungarischen Namen verwendet habe. Bildein zum Beispiel, das im Ungarischen „Hétföhely – Montagmarkt“ heißt. Zerdahel heißt „Mittwochmarkt“.
Als Burgenländer durchschaut man vielleicht eher, dass Sie im Buch Nord und Süd enger zusammenrücken, als es ist …
Es ist ja interessant: Wenn man vom Südburgenland ins nördliche Burgenland fährt, übers Rosaliengebirge, dann ist das die Scheidewand, da ändert sich der landschaftliche Charakter. Aber wenn man vom Seewinkel über Ungarn hinunter in den Süden fährt, dann ist der Landschaftswechsel nicht so stark, da ist der Übergang viel fließender. Dann ist ja kein Berg dazwischen. Jetzt geht die Fahrt ganz leicht und schnell; früher war’s ein bisschen beschwerlicher.
Das ist ebenfalls ein gutes Stichwort: Inwieweit ist für Sie die Grenze, der damalige Eiserne Vorhang, in das Buch eingeflossen?
In Mogersdorf sind wir als Kinder immer in der Raab geschwommen, durch die der Eiserne Vorhang verlaufen ist. Auf der anderen Seite sind die ungarischen Wachsoldaten gestanden und haben auf die Fische geschossen. Das hat mich natürlich sehr beeindruckt. Oder der Jagdhund eines Onkels – der ist im Minengürtel an der Grenze explodiert, als er eine Wildente apportieren wollte. Mich hat das damals schon sehr beschäftigt. Wenn man zum Beispiel von Mogersdorf nach Jennersdorf gefahren ist, hat der ganze Weg entlang des Eisernen Vorhanges geführt. Und das war sehr eindrücklich.
Also der Eiserne Vorhang an sich, der kommt aber in keiner Weise im Buch vor. Ganz im Gegenteil: Ich habe ja die Grenzen aufgemacht! Da geht’s ja bis zu den Bergen von Györ. Als ich in Mogersdorf war, sah man direkt hinüber nach Szentgothard. Und das sieht aus wie ein burgenländisches Dorf, es hat genau dieselbe Art von Kirche. Das ist auch im Seewinkel das Schöne – wenn man von einem Kirchturmspitz zum nächsten sieht. Und genau so war es in Mogersdorf, wenn man Richtung Ungarn schaute. Deshalb gab es für mich keine Grenze.
Die Grenze ist ja immer noch ein Thema im Burgenland. Wobei jetzt, vor allem im Seewinkel, die Ortschaften schon mit Bratislava zusammenwachsen …
Es wäre interessant zu wissen, ob im Burgenland jetzt Slowakisch gesprochen wird. Im Südburgenland hat man früher auch Slowenisch gesprochen. Da gab es eine slowenische Minderheit. Was die kroatischen Ortstafeln angeht, gibt es im Burgenland ja keine Kärntner Verhältnisse.
Was bei meiner persönlichen Geschichte sehr stark dazukommt: Ich habe in meinem ersten Jahr als Lehrer in Oberwart an der HAK unterrichtet, das war 1969. Damals hatte Oberwart einen starken ungarischen Bevölkerungsanteil und ich bin das erste Mal mit Roma zusammengetroffen. Sie haben in Oberwart damals praktisch in einem Ghetto gelebt, in der Roma-Siedlung. Wenn ich diese Straße hinausgegangen bin, hat man mich davor gewarnt. Gegen die Roma haben die Menschen damals ja wirklich etwas gehabt, vor allem auch die Burgenländer.
Ich erinnere mich, dass zu mir in die Sprechstunde sowohl kroatisch Sprechende, als auch ungarisch Sprechende gekommen sind, die kein Wort Deutsch gekonnt haben. Die Kinder, über die ich vielleicht etwas Schlechtes hätte erzählen können, haben übersetzt und das zensuriert, nehme ich an. Das hat mich sehr gefesselt. Das Einzugsgebiet der Schule ging bis nach Rechnitz, Schandorf, Schachendorf. Und in den Klassen hatten sicher bis zu 20 Prozent Deutsch nicht als Muttersprache.
Als ich damals in Schlaining das Haus hatte, war ich ununterbrochen in Oberwart und in Unterwart. Einer der Rom war Altwarentandler und dessen Schwiegermutter war im KZ gewesen, damit habe ich mich damals schon auseinandergesetzt. Und als man die Siedlung damals verlegt hat, sind den Roma die Häuser zugeteilt worden, die direkt an der Müllkippe lagen.
Jetzt, zum Gedenkjahr des Attentats auf vier Roma 1995 in Oberwart, gab es den Appell, die Roma-Siedlung zumindest in den Köpfen weiter ins Zentrum zu rücken.
Es ist ja auch vieles aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges im Burgenland nicht aufgearbeitet, kommt mir vor. Lackenbach, Rechnitz, Portschy …
Klaus Hoffer wurde 1942 in Graz geboren und lebt dort als Schriftsteller und Übersetzer. Sein Roman „Halbwegs. Bei den Bieresch 1“ erschien 1979, „Der große Potlatsch. Bei den Bieresch 2“ im Jahr 1983 im S. Fischer Verlag in Frankfurt/Main. Der Essay „Pusztavolk“ wurde 1991 veröffentlicht. Weitere Publikationen siehe auf der Website seines Verlages in Graz: Literaturverlag Droschl www.droschl.com
Wolfgang Millendorfer wurde 1977 in Eisenstadt geboren. Er lebt als Schriftsteller und Journalist in Mattersburg. Im Verlag edition lex liszt 12 erschienen die Erzählbände „Stammgäste“ (2007) und „Doppelgänger“ (2011), zahlreiche weitere Veröffentlichungen in Anthologien. Weitere Infos über verschiedenste Kunst-Projekte auf der Website: www.wolfgang-millendorfer.at