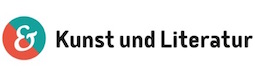Dine Petrik und Beatrice Simonsen im Gespräch am 18. November 2014 in ihrer Wohnung in Wien. Das Gespräch wurde anlässlich der Recherche für die Anthologie “Grenzräume. Eine literarische Spurensuche im Burgenland” (edition lex liszt 12, 2015) geführt.
Beatrice Simonsen: Der Aufbruch aus dem Burgenland nach Wien ist für viele ein „natürlicher Weg“. Wie war das bei dir?
Dine Petrik: Mit siebzehn habe ich die Loslösung tatsächlich geschafft. Es ging bei mir immer ums Gehen. Im Laufe der Kindheitsjahre und frühen Jugend war das immer klarer geworden: wenn der Vater nicht zurückkommt, um mich zu „retten“, muss ich es selbst tun. Was mich bewogen hat, was sich in dem Haus, meinem Elternhaus, in der Nachbarschaft tagtäglich abgespielt hat, kann hier nicht artikuliert werden, umso größer die Hoffnung, dass sich mit Vaters Rückkehr alles ändern würde. Zunächst galten der 17 Jahre ältere Bruder wie auch der Vater als „Vermisste“, ein paar Jahre später ließ meine Mutter den Vater „für tot erklären“. Im Hoffen, dass er trotzdem zurückkehrt und der Frage, wo er verscharrt sein könnte, wie auch der Bruder, vergingen die Jahre. Schon in Wien habe ich die beiden über die Deutsche Kriegsgräberfürsorge suchen lassen … Mein zweiter Bruder, der als Deserteur heimgekehrt war, beging später Suizid.
Etwas, eine Kraft, die ich mir aus dem Dorf mitgenommen habe, hat mein Fußfassen in Wien unterstützt: Die Mutter hat mich als Kind an den Pflug gestellt, ich habe gearbeitet, sprich, geschuftet, bis zum Entschluss, sie zu verlassen. Mein Aufkommen in Wien: Harte Bandagen. Bürolehrgang, Fakturistin, später im pharmazeutischen Großhandel nebst anderen Brotberufen. Gewohnt auf Untermiete. Die Abende galten der Fortbildung: Abendhandelsschule Weiss. An der Kunstschule Schillerplatz und später Lazarettgasse habe ich Kurse für Zeichnen und Malen belegt gehabt, dazwischen auch gekellnert, bedient, um mich über Wasser zu halten. Gedanken an eine Rückkehr gab es nie. Die Mutter, die mir nichts Gutes nachgerufen hat, hat meinen Abgang weder akzeptiert, noch den langsam sichtbaren Wandel – den äußerlich sichtbaren, registriert, nichts hat ihren Gefallen gefunden. Dass ich mich weitergebildet habe, war ihr nichts wert.
War das eine bäuerliche Familie? Wie war dein Zuhause?
Ich bin 1942 in Unterfrauenhaid geboren, rund 900 Einwohner, neunzehn Jahre nach meinem großen Bruder, der damals im Russland-Feldzug war. Und als ich zwei war, wurde der Vater – schon an der Altersgrenze, eingezogen, angeblich wegen einer Intrige mit dem Nazibürgermeister. Jedenfalls wurde das immer fest behauptet. Der Vater war Musiker, im Maschinenhandel tätig und nebenher Kleinbauer. In diesen Kriegsjahren war ja ein Großteil der Männer nicht vorhanden, die Frauen und Kinder bestellten die Felder, das Leben ging weiter, das Korn wurde gesät und gemäht, dann kam es zur Frage: Dreschflegel. Und Vater – damals einer der wenigen in der Gegend, hatte bereits eine Dreschmaschine nebst Dieselmotor, die bei den Bauern gebraucht worden waren, er hat als „unentbehrlich“ gegolten, in einigen Dörfern war es zu Abstimmungen gekommen, doch der eigene Bürgermeister hatte ihn als „entbehrlich“ gestempelt und er wurde eingezogen. Somit hatte ich keinen Vater. Das war nicht akzeptabel. Ich hatte Hassgefühle gegen den Mann, diesen Bürgermeister, der nach dem Einmarsch der Russen zum Kommunistenbürgermeister mutiert war.
Das heißt, du hast deinen Vater fast nicht gekannt?
Aus diversen Schilderungen wusste ich, dass er eine Art Wunderknabe gewesen war. Es gab kein Buch im Haus, aber da waren seine Zeichnungen, und es gab Instrumente, mein Vater hatte eine Kapelle angelernt, an Kirtagen, Hochzeiten, haben sie gespielt, auch meine Brüder. Alle Blasinstrumente und Klarinetten wurden – bevor der Vater eingerückt ist – auseinandergenommen, die Stücke in Ölpapier gewickelt und im hinteren Stadel unter einer Strohtriste vergraben, auch Bratschen und Geigen. Wenn die Russen kommen – mit der Gefahr war wohl zu rechnen gewesen, würde alles gestohlen werden oder vernichtet. Diese Instrumente haben überlebt. Die alte Knopfharmonika, die in der Küche verblieben war, haben sich die Russen geholt. Da sind noch etliche Bilder, vom Vater nichts, ein Bild. Aber die Instrumente, sie waren mein „Missing Link“. Jede freie Minute verbrachte ich vor dem Kasten in dem sie lagerten, ich setzte zusammen, blies Töne, er stand neben mir, ich konnte ihn riechen, mit ihm reden. Das ist festgehalten: „Ein Notenstück“, in der Anthologie „Veza lebt“. Vater war also in der Gegend auch als Musikant bekannt. Diesen Vater wollte ich haben, kennenlernen. Dann bin ich gegangen.
… wohin?
Wien war und ist meine Stadt, mein Mantel, trotz Härte, trotz anfänglicher Fremdheit auf etlichen Ebenen. Aber Integration, Zugehörigkeit, ein Ich-Gefühl, hat sich auch im Dorf nie ergeben. Eine andere Herkunft haben. Später habe ich dieses Gefühl, eines wie Integration, beim Lesen entdeckt, in den Büchern. Und Wien ist mein zu Hause. Wenn ich heimfahre, am Heimatgefühl vorbei, tut mir das Herz weh. Bezugspunkte kaum. Es gibt den Friedhof, das Kriegerdenkmal, es gibt die romanisch gotische Kirche (1222 urkundlich erwähnt), es gibt ein Elternhaus, das anderen gehört und jetzt verfällt.
Wie bist du in Wien zum Schreiben gekommen?
Als Jugendliche habe ich Gedichte geschrieben. Während / nach einigen Lebensbrüchen habe ich das wieder aufgenommen, eine Art Haltesuche, während andere Haltesysteme zusammengebrochen waren. Harte Lernprozesse, das Schreiben. Der Wunsch, der Sog hin zum Schreiben war immer da, die Frage war, darf auch ich sie benutzen, diese wunderbaren Worte und Sätze, stehen sie auch mir zur Verfügung? Es entstand ein Buch: „Sonaten für Wasser und Wind“, erschien bei Edition Roetzer, das war 1990, ich war im Fünfzigsten.
Wie kamst du zu Hertha Kräftner, über die du zwei Bücher geschrieben hast?
Die Kräftners lebten zwei Jahre, von 1934 – 36, in Neutal, einen Steinwurf von Unterfrauenhaid entfernt. Hertha absolvierte in Neutal die ersten zwei Volksschul- klassen. In einem Notizbuch meines Vaters – ich fand es im Stadel im Schutt, sah ich beim Durchblättern „Kräftner Neutal“. Offenbar hat er in dem Büchl seine Tagestermine festgehalten, laut Auskunft meiner Mutter machte er auch Transportfahrten mit Traktor und Anhänger, letzterer hatte große, aufblasbare Gummiräder, ich sehe sie noch. Nun, genau konnte mir das keiner sagen, aber womöglich hat er den Kräftner-Umzug von Neutal nach Mattersburg gemacht. Für mich eine Art Bezugspunkt, Ausgangspunkt. Einige Kräftner-Gedichte kannte ich schon als Jugendliche. Als ich später ihre Gedichte las, fand ich sie dunkel und spröde. Ihr Leben interessierte mich aber. 1997 erschien „Die Hügel nach der Flut. Was geschah wirklich (…)“ bei Otto Müller.
Und warum noch ein zweites Buch 2011 „Die verfehlte Wirklichkeit“ über sie?
Ja, warum … Mir die Kräftner-„Bearbeitungen“ vor Augen haltend, war zunächst eines auffällig: Ein Herunterziehen und zugleich Hochheben. Als „nicht normal, weil depressiv“ wurde sie hingestellt, das Hauptinteresse galt ihren Liebschaften, ihrer „Vielmännerei“, als „Nymphomanin“ wurde sie festgemacht. Und sonst? Die Auslöser für ihre Beschädigungen, Zerrüttungen waren vernachlässigbar gewesen. Ich hatte andere Zugänge und Fragen: Was passierte im Kräftnerhaus in der Lisztgasse 24 beim Eintritt des russischen Offiziers, der ein Blutbad anrichtet – zwei Schwerverletzte (darunter eine Fünfjährige) und eine Tote, mit der 17 jährigen Kräftner, bzw. ihrem Innerem? Sie hat das einfach so weggesteckt? Sie trug „nicht“ an der ihr zugewiesenen Schuld in den Augen der MattersburgerInnen? Wurde ihr dieses Gefühl genommen, sie gefragt, wie gehts, brauchst du was? Woher nahm die „zartbeseitete“ die Kraft, das Haus, die Stube, den steten Verletzungsort Mattersburg trotzdem immer wieder zu betreten? Und da waren andere Fakten, nicht wirklich zum Hersagen, Fakten, die zu verschweigen waren, die Frauen verschwiegen oder in den Suizid getrieben haben; die Auslöser zahlreicher Störungen wie manisch-depressiv, bipolar etc. wie man das heute nennt.
Ja, ich fing wieder an, zweites Buch. Zum Sager „von Kind an depressiv.“ Sie selbst schrieb: „Ich war ein ruhiges, klares Kind, aber die Ereignisse am Kriegsende …“ Nun, öfter auch bei Kräftners Bruder Günter nachgefragt, recherchiert. Zum Sager „… vier auf einmal“, die sie zuletzt gehabt haben soll: Da war Harry Redl, der, während sie 1950 in Paris auf ein Treffen hofft, nach Kanada emigriert war. Es gibt intelligente, berührende, ums Leben ringende Briefe von Kräftner, nicht nur an die kurze Affaire Redl. Sie hat sich Halt versprochen, ein Handlungsbündnis, eine Hand. Sicher ein Fehler, die Haltsuche bei Männern. Otto Hirss, ihre wohl schmerzlichste Lebenserfahrung, der, sowie er von der Nachricht ihres Todes (Veronal) Kunde hat, ihren Nachlass an sich rafft, um ihn zu vermarkten. Otto Hirss, mit dem sie vier Jahre zusammen gewesen war. Zuletzt Wolfgang Kudrnovsky, „der ihr den letzten Stösser gegeben hat“, wie mir einer seiner Freunde gesagt hat. Und mit dem Viktor Frankl soll sie … wie zu hören und lesen gewesen war. Nein, da war null! In den umfassenden Textgespinsten „Beschwörungen eines Engels“ – Engel meint Frankl, hat Kräftner Halt gefunden, diese „Beschwörungen“ sind Fiktion und sonst nichts. Am Leben erhalten hat sie das nicht. Nun, für mein Buch gab es immerhin positive Rezeptionen, insbesondere in der Süddeutschen Zeitung.
Noch zu einem anderen Thema, das dir wichtig ist: das Reisen, über das du in „Jenseits von Anatolien“ geschrieben hast.
Nicht nur in dem Buch habe ich über das Reisen geschrieben. Da waren von Kind an Sehnsuchtsorte, Sehnsuchtsworte: Troja, von einem Schliemann zu lesen, der die Stadt ausgegraben hat; was der sonst noch ausgegraben hat. Homers Odysse lesen. Babylon. Ägypten. Mythen und Geschichten. Sollte ich etwas im Leben schaffen, dann muss ich auf diesen Böden stehen. Ich habe meine Familie nach Troja geschleppt, die Kinder waren noch ziemlich klein, wie auch nach Ägypten: Weltwunderboden. Als Kind unvorstellbar, dass es Jahrtausende vor der Zeitrechnung Hochkulturen gegeben hat. Die Schrift, Mathematik, Architektur, die Pyramiden, die die Menschheit überdauern werden. Sehnsuchtsorte, die ich aufsuchen durfte. Und in den Irak: Uraltes Agrarland, erste Gesetze unter Hammurapi. Ninive. Nimrud, Babylon, Ur. Uruk. Ich war da, als Saddam noch regiert hat. Mein Gefühl, dass das Sehnen nach diesen Orten war da, bevor ich über sie las, lernte, wusste.
Woher hattest du dieses Wissen? Durch die Schule?
Bücher, mir Bücher besorgt, ausborgt. Schule ja, vernachlässigbar, wie gesagt, ging es um anderes. In der letzten Zeit daheim kamen Bücher ins Haus: man war bei Donauland. Außer mir hat keiner gelesen. Und der Konzern in Wien, in dem ich jahrelang gearbeitet habe, hatte eine Betriebsbücherei. Ich habe gelesen und alles Historische verschlungen.
Das heißt, du hast dir die Bildung praktisch selbst erarbeitet?
Und. Schon bin ich in einer Verteidigungsstellung. Bildung. Nicht jeder hat die Chance auf eine, hat die Chance auf ein Studium. Nicht jeder kann auf „Herkunft“ pochen. Jahrelang habe ich mir eine andere gewünscht. Solche, wie mich, hat und wird es geben. Und es trotzdem wagen: Das Leben, das Schreiben, das Wissenwollen-und-müssen. Lernprozesse bis heute. Ich stehe zu meinen – wie ich gern sage, drei Leben, ich stehe zu meinem dritten, selbstbestimmten. Schreiben und Leben. Hineinsinken in bereichernde Welten. Eine wunderbare Erfahrung, ein großes Geschenk, eine Magie.