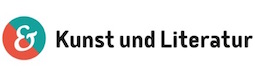Renate Welsh-Rabady, bewährte Autorin aus der starken Riege österreichischer Kinder- und Jugendliterat_innen, schreibt ebenso für Erwachsene und feiert im Dezember 2017 ihren 80. Geburtstag.
Die Autorin im Gespräch mit Beatrice Simonsen
In Ihrem stattlichen literarischen Werk, an dem Sie seit fast fünfzig Jahren und immer noch unermüdlich arbeiten, verschwimmen oft die Grenzen zwischen Jugend- und Erwachsenenroman. Ihre Bücher sind für alle Altersgruppen interessant und spannend zu lesen. Andererseits sind Sie auch mit Kinderbüchern, besonders mit der Figur des „Vamperl“ sehr bekannt geworden. Wie sind Sie denn eigentlich zum Kinderbuchschreiben gekommen?
Das war eine typische 68er-Jahr-Entscheidung: Ich wollte etwas gegen Vorurteile tun, weil ich dachte, dass Vorurteile der größte Bremsklotz sind, der Menschen daran hindert so zu sein, wie sie eigentlich gern sein möchten. Um gegen Vorurteile anzugehen, muss man sie dort erwischen, wo sie noch nicht das ganze Menschengewebe durchwachsen, sondern erst kleine Würzelchen haben – und da muss man bei Kindern anfangen. Da war die Entscheidung, Kinderbücher zu schreiben, naheliegend. Das war eine sehr klare Entscheidung. Es war auch die Zeit, in der ich mit Kindern im Krankenhaus arbeitete und ziemlich viel schlechtes Gewissen hatte, weil ich so deutlich erlebte, wie groß der Vorteil war, den meine eigenen Kinder gegenüber vielen anderen hatten. Die sind zwar mit sehr viel weniger materiellen Gütern aufgewachsen, hatten aber den ungeheuren Vorteil an Sprache, an Möglichkeiten … Da hab ich gedacht: Dagegen muss man was tun.
Sie haben sehr jung geheiratet und Kinder bekommen …
Viel zu jung! Ich hab zwei Söhne aus dieser ersten Ehe und es ist gut, dass es die gibt. Wir können ganz gut miteinander.
Aber Sie haben nicht – wie manche andere – aus dem Impuls begonnen, für Ihre eigenen Kinder zu schreiben?
Nein. Das, was ich für meine Kinder erfand, hab ich nie aufgeschrieben. Das waren private Geschichten, die aus dem entstanden sind, was wir zusammen erlebt haben.
Sie haben aber auch als Übersetzerin gearbeitet …
Ich bin sehr lange sehr vertraut mit der englischen Sprache gewesen. Meine erste Matura machte ich in Amerika, weil ich mit fünfzehn Jahren dorthin kam. Das war damals – 1953 – eine große Sache. Aus dieser Vertrautheit heraus begann ich später zu übersetzen. Als ich dann einsah, dass ich leider keine neue Literaturform erfinden werde – weil das immer schon irgendwelche grauslichen Leute vor dreißig Jahren erfunden hatten, was ich erfand – setzte ich meine Sprachverliebtheit beim Übersetzen ein. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich hab dabei viel gelernt. Ich glaub, dass Übersetzen eine weitgehend unterschätzte und sehr wichtige Tätigkeit ist.
Haben Sie mit dem Übersetzen dann zugunsten des literarischen Schreibens aufgehört?
Als das Schreiben zu meiner größten Überraschung eine Möglichkeit wurde, davon zu leben, hat es das Übersetzen verdrängt.
Was war Ihr erster durchschlagender Erfolg?
Das war der Roman „Johanna“ (Anm.: erschienen 1979). Der ist hier in Hilzmannsdorf (Anm.: dem Landsitz der Autorin in der Buckligen Welt) entstanden. Es war die Geschichte meiner Nachbarin. Eine Geschichte, die in den 1930er Jahren in Österreich spielt und die mich sehr beschäftigt hat. Sie war eine Frau, die ich sehr schätzte, sehr mochte und die überhaupt keine Chance auf der Welt hatte. Nachdem ich alles, was man für das Leben auf dem Land lernen muss, von ihr lernte, und nachdem sie für mich auch so eine Art Mutterersatz war in ihrer Lebensklugheit, in ihrer unsentimentalen Freundlichkeit, erzählte sie mir wie sie in dieses Dorf kam – und das hat mich sehr schockiert.
Sie war damals dreizehn Jahre alt, hatte die acht Jahre Schulpflicht hinter sich. Sie war das uneheliche Kind einer Dienstmagd, die das uneheliche Kind einer Dienstmagd war und so fort … Generationen weit zurück. Aber sie hatte Glück mit ihren Zieheltern, die sagten: „Am besten du gehst dorthin zurück an die Dienststelle, wo deine Mutter gearbeitet hat, weil hier bei uns – das war im südlichen Burgenland – gibt’s keine Lehrstellen. Und Einheiraten kannst du auch nirgends, weil g’heirat wird nur eine, die so viel hat wie man selber. Und so viel wie du nix hast, gibt’s ja ned.“ So kam sie hierher nach Hilzmannsdorf und der Armenrat wollte sie gleich als Dienstmagd nehmen. Aber sie sagte: „Nein, das war nicht ausgemacht. Ausgemacht war, dass ich was lernen darf. Ich will Schneiderin werden.“ Und der Armenrat hat einen klassischen Satz gesagt, das war 1931: „Wo kämen wir da hin, wenn ledige Kinder was wollen dürfen.“ Das war gerade die Zeit, als die Diskussion aufkam, ob unehelich geborene Kinder den ehelich geborenen gleichgesetzt werden sollten.
Mir hat dieser Satz, der einem Menschen eigentlich die Menschenwürde abspricht, die Augen geöffnet. Das war absolut unmöglich, diesen Satz zu akzeptieren, weil er eine Frau betraf, die ich so bewunderte, die mir geholfen hat, mich aus dem Gewurschtel meiner persönlichen Vergangenheit herauszuarbeiten. Und sie dachte immer noch, sie müsste der Welt beweisen, dass sie was wert ist. Und deshalb wollte ich ihr ihre Vergangheit so zurückgeben, dass sie mit Stolz sagen kann: „Das bin ich.“ Da hat sie zuerst natürlich „Nein“ gesagt. Sie hat sich bei mir umgeschaut, hat die Familienportraits bei mir an der Wand gesehen und sagte: „Nein, das kann man nie verstehen, wie das ist, wenn man da her kommt, wo ich herkomm.“
Es ist mir aber doch gelungen, dass sie mir erlaubt, dass ich es schreib. Es war damals eine sehr große Arbeit, die 1930er Jahre in Österreich zu recherchieren – 1965 bis 1978 arbeitete ich daran. Es gab eigentlich kaum etwas zu dem Thema, nur zwei Dissertationen. Ich las einfach alles aus dieser Zeit, was mir in die Hände kam, alle Zeitungen vom Kaninchenzüchterverband- bis zum Gewerkschaftsblatt soweit sie vorhanden waren. Sehr viel ist verbrannt, die Russen waren hier in der Gegend. Und ich redete mit Zeitzeugen – es war eine sehr aufwändige Recherche.
Als ich fertig war, hat der Verleger – Dr. Leiter bei „Jugend und Volk“, den ich sehr mochte – gesagt: „Na Seawas, du hast uns ein Ei gelegt! Wir werden nix als Schwierigkeiten haben. Es gibt kein Fettnäpfchen, in das du nicht hineintrampelst. Jenseits der Weißwurschtgrenze wird es keiner lesen, weil es voll von Austriazismen ist und die kann man auch nicht ausbügeln, weil man kann nicht eine Dirn in Niederösterreich aufs Kartoffelfeld mit der Harke schicken. Das geht halt nicht, weil die Sprache und die Landschaft zusammengehören. Du musst schauen, dass du von den Übersetzungen lebst, weil Lesungen kriegst du sicher keine.“
Zu unser aller Überraschung hat das Buch den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen und es gab ein paar Veranstaltungen zum Sauschlachten – wo ich als Sau eingeladen war (sie lacht). Aber dann sind bei den Lesungen ehrenwerte alte Bibliothekare aufgestanden und sagten: „Der Herr oder die Frau Professor Sowieso werden es sicher besser wissen, aber ich muss sagen: die Geschichte von meiner Tante war genauso. Genauso war’s.“ Und plötzlich hat es nicht mehr geheißen, dass ich sozialistische Parteigeschichte geschrieben hab, sondern es wurde als historisches Dokument anerkannt.
Das war alles noch vor dem „Vamperl“ und es hatte tatsächlich eine große Wirkung für mich – dass ich „Geschichte von unten“ geschrieben hab, das hat etwas ausgelöst.
Das meinte ich zuvor, dass Ihre Bücher in ihrer Mischung aus Dokumentation und lebendiger Geschichte gleich spannend für Jugendliche wie für Erwachsene zu lesen sind. Und wie ging es dann weiter?
Kurz darauf hab ich das „Vamperl“ (Anm.: erschienen 1979) geschrieben – man braucht eben ein Kontrastprogramm. Als ich die Idee mit dem „Vamperl“ hatte, erkannte ich zuerst gar nicht, dass die Idee wirklich trächtig war (Anm.: es folgten bis 2010 mehrere „Vamperl“-Bände). Erst ein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Aber schon die „Johanna“ hat sich kurz nach dem Erscheinen irrsinnig gut verkauft – als gebundenes Buch gingen 70.000 Stück über den Verkaufstisch, das war für meine Begriffe ein heller Wahnsinn! Vor allem in Norddeutschland ging es gut und in Frankreich auch. Ich weiß gar nicht, in wie viele Sprachen es übersetzt wurde.
… und hat die Nachbarin es gelesen?
Zuerst hat es ihr Mann gelesen, ihre Töchter, ihre Enkeltöchter … und sie sagte zu mir: „Die sagen jetzt zu mir «Oma, du musst deppert gewesen sein, dass du dir das hast gefallen lassen«, aber sie sagen auch «Oma, du bist schon cool gewesen.«“ Sie hat es lange nicht gelesen. Sie sagte zu mir: „Ich hab es leben müssen, jetzt soll ich es auch noch lesen?“ Ich bin ja wie eine tragerte Katz um sie herumgeschlichen, weil ich mich so vor dem gefürchtet hab, was sie dazu sagen wird, und dass ich eine Figur aus dramaturgischen Gründen dazuerfand. Aber irgendwann sagte sie: „Jetzt möchte ich aber eines wissen: Wieso hast du auch das geschrieben, was ich dir nicht erzählt hab?“ Das fand ich sehr schön, diese Erfahrung, dass man beim Schreiben plötzlich mehr weiß als man eigentlich weiß. Das kann man nicht erklären, das hat nichts mit Übersinnlichkeit zu tun, sondern mit einer anderen Art von Konzentration, glaub ich.
Und da war noch etwas, was mir wirklich Spaß gemacht hat: Meine Nachbarin von der anderen Seite fand es total ungerecht, dass ich über die eine ein Büchl gemacht hab und sie muss sich selbst einen Grabstein kaufen (sie lacht). Da hab ich gedacht: Wenn mein Buch so viel wert ist wie ein Grabstein, dann hab ich einen anständigen Beruf. Im Sinn von nützlich.
Die starken, oder vielleicht mütterlichen, Frauen haben Ihnen offenbar angetan … Auch im „Vamperl“ gibt es so eine starke Frau – die Frau Lizzy.
Ich hab ein absolutes Mutterdefizit. Meine Mutter starb mit achtundzwanzig Jahren und dieses Defizit spürt man durch. Meine arme Stiefmutter konnte das nicht abdecken. Alle mütterlichen Frauen, denen ich begegnet bin – unter deren Fuchtel ich gestanden bin! – spielen irgendwie eine Rolle. Die Frau Lizzy ist eigentlich unsere Putzfrau gewesen und die hat mich so unterm Daumen gehabt. Ich hab sie heiß und innig geliebt.
Jetzt noch eine Frage zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Schreibpädagogin: Was treibt Sie schon seit vielen Jahren dazu an?
In der Hauptsache biete ich Schreibwerkstätten für Obdachlose in der Vinzi Rast an. Da ich aber auch sehr oft in Schulen Lesungen halte, werde ich manchmal dort zu Schreibwerkstätten eingeladen, weil mich die Lehrerinnen kennen und meinen, die Kids würden das brauchen.
Worum geht es Ihnen dabei?
Egal wo ich es mache: Ein ganz zentraler Punkt ist für mich, dass ich glaube, dass drei Viertel aller Agressionen und drei Viertel aller politisch gefährlichen Tendenzen ihre tiefste Wurzel in der Sprachlosigkeit haben. Ich glaube, dass ein Großteil der Sprachlosigkeit gemacht ist und damit zu tun hat, dass den Leuten nicht zugehört wird. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man Menschen mit einfachsten Mitteln die Zunge lösen kann. Die Schreibwerkstatt soll in Wirklichkeit zu einem aktiven Zuhören führen. Die Leute merken dann: Man hört mir zu! Und wenn man mir zuhört, heißt das: Ich bin etwas wert! – und in dem Moment, wo ich etwas wert bin, bin ich auch solidaritätsfähig. In dem Moment, wo ich etwas wert bin, bin ich nicht mehr Stimmvieh, muss ich mich nicht mehr mit Ellbogen durchsetzen, sondern kann auch akzeptieren, dass viele unterschiedliche Wahrheiten miteinander eine größere bunte Wahrheit ergeben, als wenn ich nur meine Wahrheit durchzusetzen versuche. Das ist jetzt alles fürchterlich verkürzt. Aber darum geht’s eigentlich. Insofern hab ich noch ein Stück von meiner Naivität, mit der ich angefangen hab, behalten, und glaube, dass man ein bissl was zum Guten verändern kann auf der Welt.
Das Gespräch fand am 1. August 2017 in Hilzmannsdorf statt.
Fotos © Ernst Gembinsky